Interview mit Prof. Matthias Stoll, Hannover
Wie AMNOG künftig den Zugang zu Innovationen erschweren könnte
 Das
AMNOG sieht vor, dass der Preis für Medikamente anhand ihres
Mehrwertes gegenüber einer Vergleichsmedikation festgelegt wird. Nur
Medikamente, die mehr können, dürfen auch mehr kosten. Was wird da
genau verglichen?
Das
AMNOG sieht vor, dass der Preis für Medikamente anhand ihres
Mehrwertes gegenüber einer Vergleichsmedikation festgelegt wird. Nur
Medikamente, die mehr können, dürfen auch mehr kosten. Was wird da
genau verglichen?
Prof. Stoll: Verglichen werden in der Regel Wirksamkeit und an zweiter Stelle Verträglichkeit. Welches Medikament bzw. Regime zum Vergleich herangezogen werden, bestimmt nicht der Hersteller, sondern der G-BA allein das IQWIG. Als Vergleich für Darunavir/Cobicistat beispielsweise würde der G-BA das Institut vermutlich nicht – wie man vielleicht denken könnte, die korrespondierende Substanzklasse – Lopinavir/Ritonavir oder Darunavir/Ritonavir heranziehen, sondern eher eine Kombination mit Rilpivirin, Elvitegravir oder generischem Efavirenz. Und nachdem die virologische Wirksamkeit der meisten Substanzen bzw. Regime bei Wildtyp-Viren bekanntermaßen vergleichbar ist, wird es hier vermutlich keinen oder nur einen geringen Zusatznutzen geben. Der Preis könnte somit auf dem – gegenüber dem derzeitigen Apothekenverkaufspreis von Darunavir – um etwa zwei Drittel niedrigeren Niveau des NNRTI-Generikum landen – vielleicht 5% mehr im Falle einer besseren Verträglichkeit.
Das Risiko, auf einen niedrigeren Preis zurückzufallen, ggf. auf Generika-Niveau ist für ein Unternehmen sicher kein Anreiz eine Weiterentwicklung Innovation in Deutschland einzuführen. Im Fall von Darunavir/Cobicistat könnte es das Unternehmen bei der Einführung sogar noch Verluste machen...
Prof. Stoll: Das ist richtig. Prezista® mitsamt zugehörigem Booster ist derzeit die teuerste antiretrovirale Erstliniensubstanz in Deutschland. Der Proteasehemmer wurde vor 2011 eingeführt und musste als „Altsubstanz“ den AMNOG-Prozess nicht durchlaufen. Nach Einführung einer preisgünstigen Fixkombination Darunavir/Cobicistat würden die Verordnung der teureren Einzelpräparate vermutlich aus Gründen des Wirtschaftlichkeitsgebots viel schwerer zu rechtfertigen sein wäre der Markt für die höherpreisigen Einzelkomponenten tot. Und Mehrverordnungen der neuen Fixkombination, die diese Mindereinnahmen ausgleichen könnten, sind auch nicht in Sicht... Eine solche Entwicklung mag aus Sicht der Versicherten und aus Sicht der Kostenträger vielleicht sogar überfällig erscheinen. Es darf aber niemanden verwundern, dass ein börsennotiertes Pharmaunternehmen vermutlich dabei zögern wird, von sich aus einen Prozess in Gang zu setzen, dessen Folge ein geschmälerter Unternehmensgewinn sein dürfte.
Der AMNOG-Prozess kostet die Firmen zudem auch noch eine Stange Geld ...
Prof.
Stoll: Die Unternehmen
müssen Dossiers einreichen. Diese umfangreichen Datensätze sind von
enormer
Bedeutung für die
Firmen und werden daher von einer Vielzahl von internen
Mitarbeitern sowie externen Spezialisten
und Beratern erstellt. Die Kosten für diesen Aufwand sind nicht
unerheblich und bewegen sich geschätzt im Bereich von einer halben
Million Euro.
Wenn man ein Präparat in Deutschland nicht einführen will, warum wird dann überhaupt eine Zulassung beantragt?
Prof.
Stoll: Europa
ist nach den USA der wichtigste Pharmamarkt und die Zulassungen
werden heute generell über eine europäische Behörde abgewickelt.
Deutschland spielte hier vor AMNOG eine zentrale Rolle im
europäischen Markt. Innovative Produkte wurden stets in Deutschland
am schnellsten eingeführt, da der Preis hierzulande recht
frei
festgelegt werden konnte. Das hatte enormen Einfluss auf die
Preisgestaltung im übrigen Europa. Und auch heute wird noch auf den
Preis in Deutschland geschielt. Wenn der deutsche Preis niedrig ist,
wird es in den anderen Ländern schwierig, höhere Preise zu
rechtfertigen.
Droht hier die Gefahr, dass aufgrund von AMNOG in Deutschland innovative Medikamente im übrigen Europa, aber nicht in Deutschland zur Verfügung stehen werden?
Prof. Stoll: Diese Gefahr sehe ich auch. Janssen-Cilag ist nicht die erste Firma, die seit Implementierung des AMNOG ein Produkt in anderen europäischen Ländern auf den Markt bringt, aber nicht in Deutschland. Im Gegensatz zur Zeit vor dem AMNOG akzeptiert das deutsche Gesundheitswesen nun nicht mehr jeden Preis. Wir bekommen neue Medikamente eben nicht mehr wie früher sofort zur Verfügung, sondern eben erst später als die anderen oder vielleicht auch gar nicht.
Für dieses – im AMNOG übrigens ausdrücklich vorgesehene – Vorgehen habe ich im Übrigen durchaus ein gewisses Verständnis. Wir leben in einem Land, in dem die politische Maxime ist, sein Gesundheitssystem und die medizinische Forschung vor allem über die Prinzipien des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs zu steuern. Die großen, meist international agierenden pharmazeutischen Unternehmen sind ganz entscheidend ihren Aktionären verpflichtet und die komplexen Spielregeln des AMNOG-Prozesses wurden nicht durch sie, sondern vom deutschen Gesetzgeber so eingeführt.
Wie sieht die Zukunft aus? Wird es im HIV-Bereich überhaupt noch Innovationen geben?
Prof. Stoll: Im HIV-Bereich nimmt die Preisdiskussion erst ganz langsam Fahrt auf. Die ersten Generika waren noch kaum billiger als die Originale, aber es kommen immer mehr Generika-Anbieter dazu und die Preise fallen und sie werden noch weiter fallen. Der große Preisrutsch steht uns aber noch bevor. Bei vielen antiretroviralen Präparaten laufen die Patente 2017-2019 aus. Dann wird – im Sinne der AMNOG-Bewertung – ein Mehrwert gegenüber den jetzt schon hoch wirksamen ART-Optionen und damit ein höherer Preis für neue Medikamente kaum noch realisierbar sein. Wir stehen somit am Anfang eines großen Preisverfalls, was Pharmafirmen nicht zu Investitionen in neue Medikamente motiviert. Diese mit dem AMNOG ausdrücklich beabsichtigte Entwicklung wird aber nicht unbedingt auch dem langfristigen Bedarf nach Innovationen gerecht – man denke nur an den Antibiotika-Markt.





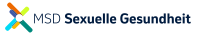




 Diese Seite weiter empfehlen
Diese Seite weiter empfehlen
