Interview mit Dr. Michael Seilmaier, München
Die erste Welle in München
Sie haben die ersten Corona-Infizierten in München betreut. Das waren einige wenige Personen, die sich bei einem Firmenmeeting angesteckt hatten. Haben Sie damals schon das Ausmaß der Krise geahnt?

Dr. Michael Seilmaier
Oberarzt
Krankenhaus
München Schwabing
Seilmaier: Ehrlich gesagt, nein. Die Bilder aus Wuhan waren erschreckend, doch niemand hatte damals vorhergesehen, mit welcher Gewalt uns dieses Virus heimsuchen wird. Selbst als die ersten Infektionen in München auftraten im Rahmen des besagten Firmenmeetings, haben wir das Ausmaß der Krise nicht geahnt. Die Informationen aus China waren zunächst ja auch noch sehr lückenhaft. Niemand – auch das RKI nicht – wollte damals unnötig Panik schüren wegen eines vermeintlich „harmlosen“ Virus. Dies erwies sich dann sehr bald als Fehleinschätzung.
Die Schwabinger Infektiologie war zu Beginn der Epidemie die erste Anlaufstelle in München. Wie haben Sie das erlebt?


©München Klinik/Klaus Krischock
Seilmaier: Nachdem außerhalb der Firma Websto Corona-Infektionen bekannt wurden, ging es los. Da kam schon gleich eine große Welle auf uns zu, denn das Tropeninstitut und wir waren natürlich durch die Medienberichte als Corona „Zentren“ bekannt. Zu dieser Zeit waren die virologischen Testkapazitäten auch noch sehr gering und die Verunsicherung auch im ärztlichen Bereich sehr groß. und wir wurden mit Anfragen zu Corona und Testmöglichkeiten auf Covid-19 bombardiert.
Wie haben Sie das gelöst? Anfänglich war die Testkapazität ja sehr begrenzt…
Seilmaier: Anfangs wurde jeder auf SARS-CoV-2 positiv getestete Patient, unabhängig von der Schwere der Symptomatik, auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zur Behandlung unter Quarantäne stationär eingewiesen. Wir haben bei den ersten Patienten tägliche virologische Untersuchungen durchgeführt, auch aus wissenschaftlichen Gründen, v.a. aber auch um selbst zu sehen, wie lange findet man in welchen Körperkompartimenten das Coronavirus.
Wir hatten in der stationären Versorgung, auch dank der Kooperation mit dem mikrobiologischen Labor der Bundeswehr, immer ausreichend Testkapazitäten. Wir haben dabei festgestellt, dass auch asymptomatische Personen das Virus lange ausscheiden können. Aber auch im Verlauf symptomfreie Patienten konnten damals erst entlassen werden, wenn in den Abstrichen kein PCR Signal mehr vorhanden war. Dies hat sich im Verlauf dann natürlich sehr schnell geändert als die Fallzahlen zunahmen und klar wurde, dass die Betten für die zunehmende Anzahl schwerer erkrankter Patienten erforderlich war.
In Norditalien war das Gesundheitssystem mit dem COVID-Ausbruch überfordert. Wie war die Lage am Schwabinger Krankenhaus?
Seilmaier: Wir haben früh mit der Vorbereitung begonnen. Anfang März wurde das ganze Krankenhaus umstrukturiert. Elektive OPs wurden gestrichen, viele Stationen für COVID leergeräumt. Wir hatten somit genug Betten. Beatmungsplätze und Intensivbetten drohten knapp zu werden. Problematisch war zu dieser Zeit auch noch der Mangel an Masken und Schutzkleidung. Der Markt war leer und trotz intensiver Bemühungen konnten oft nur kleinere Kontingente geliefert werden. Glücklicherweise hat es immer noch gereicht und zuletzt war die medizinische Schutzausrüstung wieder gut verfügbar in Europa. Der zwischenzeitlich drohende Mangel hat somit nicht zu einer limitierten Versorgung geführt.
Wie war die Belastung für das medizinische Personal?
Seilmaier: Neben der reinen zeitlichen Belastung war vor allem die psychische Belastung groß. Wir hatten die Bilder aus Norditalien im Kopf und sind einige Wochen davon ausgegangen, dass das auch auf uns zukommt.
Kam es auch beim Personal zu Infektionen?
Seilmaier: Ja, zu Beginn hatten sich mehrere Ärzte/Ärztinnen und Pfleger/Schwestern angesteckt, interessanterweise häufig nicht in der Klinik, sondern außerhalb. Sehr vulnerabel für Infektionen beim Personal war der Bereich der Notaufnahmen.
Wir haben dann aus diesen Erfahrungen sehr schnell gelernt, alle Mitarbeiter konsequent mit Schutzausrüstung ausgestattet, eine vorgeschaltete Triage implementiert und Patientenwege strikt getrennt.
Zu Beginn wusste man ja nicht viel über den möglichen Verlauf von COVID-19. Wie sind Sie mit dieser Schwierigkeit umgegangen?
Seilmaier: Wir hatten ja schon etwas Erfahrung, nachdem wir den ersten kleinen Corona-Ausbruch in München begleitet hatten. Allerdings mussten und müssen natürlich auch wir uns intensiv mit diesem neuen Krankheitsbild beschäftigen. COVID-19 ist eine sehr facettenreiche Erkrankung und vieles ist anders und neu. Hier ist nach wie vor der intensive interdisziplinäre Erfahrungsaustausch extrem wichtig. Prädiktoren für einen schweren Verlauf sind häufig therapierefraktäres und anhaltend hohes Fieber sowie im Verlauf ansteigendes CRP und LDH bei negativem PCT.
Heute im Rückblick auf die erste Welle: Was war gut, was war schlecht, was müssen wir besser machen?
Seilmaier: Gut war, dass wir doch relativ schnell gehandelt haben und in den Münchner Kliniken alle ohne Rücksicht auf Eigeninteressen konstruktiv zusammengearbeitet haben. So konnten wir schnell Lösungen finden und alles Notwendige umsetzen. Schwierig war initial der Mangel an Material und an Schutzkleidung, wobei wir das in Deutschland sehr schnell und gut in den Griff bekommen haben. Sicherlich verbesserungswürdig ist die Reaktion auf regionale Ausbrüche. Man hat die Ausbreitung über Ischgl zu spät wahrgenommen und Risikogebiete zu eng definiert. Wir leben in einer globalisierten Welt und das Virus reist mit den Menschen. Aber da sind wir natürlich auch und v.a. auf die Informationen der lokalen Gesundheitsbehörden der einzelnen Länder angewiesen. Wie eingangs erwähnt, wurden konkrete Daten aus China zunächst nur verspätet bekannt, was dann die nationalen wie auch internationalen Reaktionen verzögert hat.






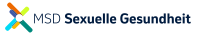




 Diese Seite weiter empfehlen
Diese Seite weiter empfehlen
